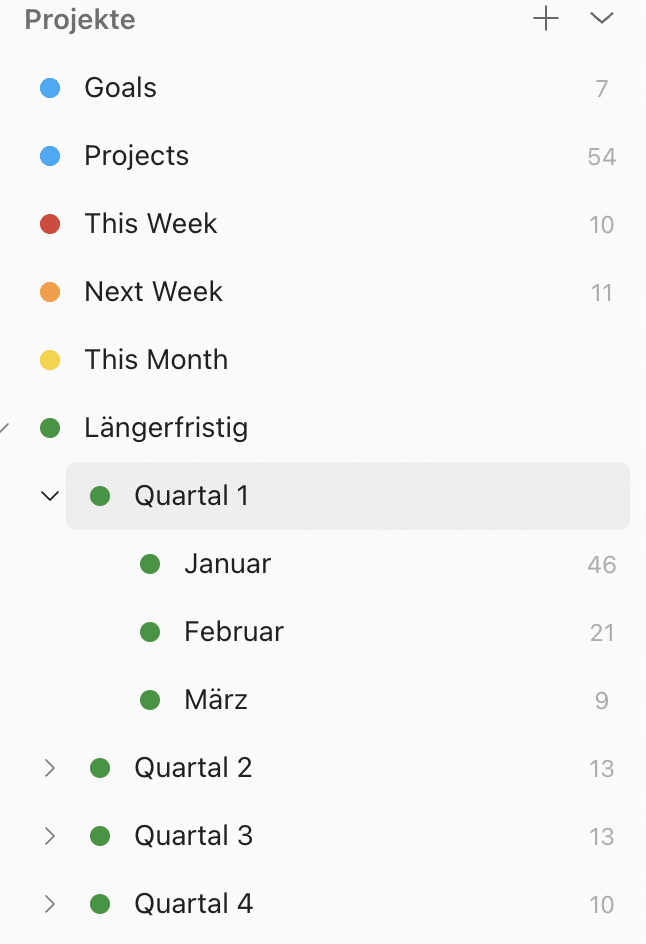Manchmal dauert es Jahre, bis Erkenntnisse richtig reifen. Ich habe kürzlich eine wichtige Lektion über Leadership und Unternehmensführung gelernt. Vielleicht hilft sie Dir auch. Es geht um das positiv-kritische Eltern-Ich aus der Transaktionsanalyse.
Transaktionsanalyse kurz erklärt
Damit Du meinen Gedanken nachvollziehen kannst, braucht es eine kurze Erklärung. Die Transaktionsanalyse spricht von mehreren Ich-Zuständen, in denen Du Dich befinden kannst. Das Eltern-Ich, das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Das gleiche gilt für Dein Gegenüber. Je nachdem, aus welchem Zustand die Transaktion eingeläutet wird, antwortet ein anderer Zustand, damit die Transaktion entsteht.
Nun wäre es sehr toll, wenn wir alle immer im Erwachsenen-Ich interagieren würden. Das ist aber leider nur selten der Fall. Ganz im Gegenteil. Das Erwachsenen-Ich ist eher der Vermittler zwischen den anderen beiden, meist öfter vorkommenden, Ich-Zuständen.
Komplizierter wird es noch, wenn man bedenkt, dass es verschiedene Arten dieser Zustände gibt. Das Eltern-Ich kann fürsorglich oder kritisch sein, das Kind-Ich rebellisch, angepasst oder frei. In den Begriffen liegt übrigens keine Wertung. Sie alle sind Teil von uns.
Die eigene Prägung steuert unsere Präferenzen
Nun ist man als Führungskraft oft in der Situation, dass das Eltern-Ich angesprochen wird. Ein verunsicherter Mitarbeiter, eine verärgerte Kundin, und noch viele andere Situationen triggern diesen Zustand.
Unsere eigene Vergangenheit hat dabei riesigen Einfluss. Denn jede Spielart der Zustände ist wichtig und hilfreich, je nach Situation. Als Kinder brauchten wir fürsorgliche Eltern. Und wenn wir ehrlich sind, auch manchmal die kritischen, damit wir unser Potenzial entfalten konnten.
Kinder müssen ebenfalls alle Arten bemühen. Das freie Kind lernt, indem es neue Erfahrungen sammelt und experimentiert. Nach einem (vielleicht berechtigten) Donnerwetter war es sinnvoll, ein angepasstes Kind zu sein. Und Regeln auch mal in Frage stellen, zu rebellieren, gehört ebenfalls dazu.
Im besten Fall lernen wir alle Spielarten im Laufe unseres Lebens kennen, in positiver wie negativer Ausprägung.
Was, wenn ein Role Model fehlt?
Die Lektion, die ich lernte, war, dass wir oft keine Vorbilder für bestimmte Spielarten haben. So fehlte mir eine Idee, wie das kritische Eltern-Ich positiv wirken kann. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, sind Regeln, Grenzen und Anforderungen manchmal notwendig. Sie helfen uns, einen Rahmen zu erkennen, in dem wir uns entfalten können. Wie das konkret geht, wie es sich anfühlt, ist mir fremd.
Die Folge ist, dass ich als Führungskraft das, was ich besser kenne (zum Beispiel den fürsorglichen Teil des Eltern-Ichs) unbewusst präferiert habe. Das mag sich auch richtig gut anfühlen. Als Führungskraft ist es aber nicht Deine Aufgabe, von allen geliebt zu werden. Es ist Deine Aufgabe, Dein Unternehmen oder Deinen Unternehmensbereich zu führen. Dazu gehört, Rahmen und Regeln vorzugeben, die für andere verbindlich sind – und deren Einhaltung einzufordern und zu kontrollieren.
Lerne aus meinen Fehlern
Vielleicht hilft Dir meine Erkenntnis, Deinen Job besser zu machen. Frag Dich doch mal, ganz privat, ob Deine Prägung vielleicht auch zu dominanten Verhaltensformen geführt hat. Vielleicht erkennst Du Beispiele, in denen Du auch hättest anders reagieren können.
Denn eine Folge ist auch klar: Da Führungskräfte die Kultur eines Unternehmens maßgeblich prägen, fließt ihre eigene persönliche Prägung da mit ein. Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie ihren Kunden Nutzen bringen und damit Geld erwirtschaften. Wenn sich alle lieb haben, ist das gut – solange auch die anderen Dinge funktionieren.
Das ist unsere Verantwortung. Wenn Du Dich also das nächste Mal fragst, warum etwas nicht so passiert, wie Du es Dir vorgestellt hast, kann es hilfreich sein, Dein eigenes Verhalten und Deine eigene Kommunikation näher zu betrachten.
Ein Tipp noch am Ende: Mentoring hat es mir ermöglicht, diese schmerzhafte Lektion zu lernen. Ich kann es, generell, nur empfehlen.
Bildquelle: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de