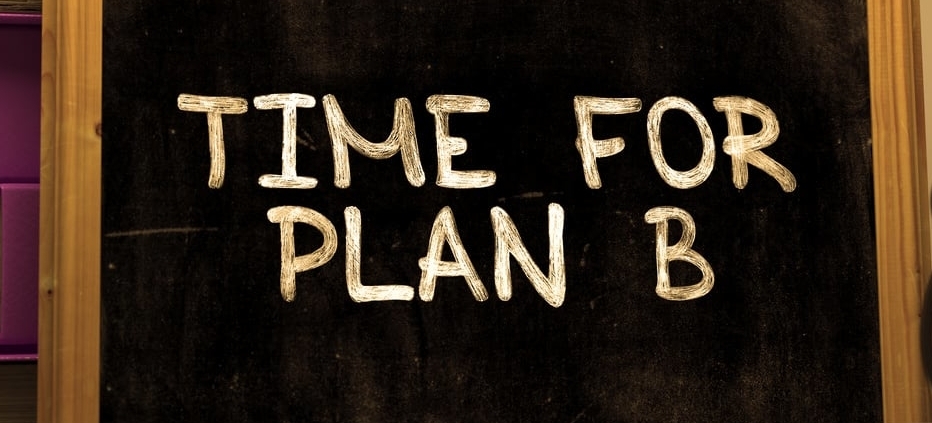Vor einiger Zeit bin ich auf Reddit über einen wunderbaren Beitrag gestolpert. Darin berichtet eine Führungskraft knapp und klar von den Lektionen, die sie gerne früher gelernt hätte. Insbesondere die erste, zu den sogenannten 1on1’s, kam mir sehr vertraut vor.
Was sind 1on1’s?
Die sogenannten „One on Ones“, also Einzelgespräche, sind ein recht beliebtes Instrument in der Führung geworden. Ich bin selbst auch ein großer Freund davon. Die Idee dabei ist, dass abseits des Alltags ein fester Termin (wöchentlich, monatlich oder quartalsweise) angeboten wird, in dem die Führungskraft mit jedem Teammitglied spricht, und das immer wieder.
Der Gedanke dahinter ist recht klug, wie ich finde. Im Alltag bestimmt ebenjener das Geschehen. Das Problem mit dem unliebsamen Kunden, der noch zu lösende Bug im Code, das anstehende Sommerfest oder das laufende Recruiting – es gibt immer etwas zu tun, was gerade dringend und wichtig erscheint. Dabei kommt aber die eigentliche Führungsarbeit am Menschen zu kurz. Denn zwischen Tür und Angel, mit einem Dutzend anderen Themen im Kopf, können weder Führungskraft noch Teammitglied sinnvoll miteinander sprechen.
Um diesem Dilemma zu begegnen, wenden viele Führungskräfte die 1on1’s an. In festen Abständen trifft man sich, in ruhiger Atmosphäre, und spricht gezielt miteinander. Dabei sollen Probleme angesprochen und gelöst werden, die Stimmung erkundet und Blocker für Dein Team aus dem Weg geräumt werden.
Alles sehr sinnvoll, oder? Sicher, wenn es richtig gemacht wird.
Der Unterschied zwischen Gespräch und Reporting
Das Problem mit diesem Instrument entsteht dann, wenn Du als Führungskraft das tust, was auch mir passiert ist. Statt Dich mit dem Menschen vor Dir zu beschäftigen, ihm oder ihr genau zuzuhören, habe ich die 1on1’s als Statusupdate-Meetings genutzt. Sie waren also ein Reportinginstrument, kein Leadership-Werkzeug.
Rückblickend weiß ich auch, warum das so kam. Es war für beide Seiten einfacher und fühlte sich auch so an. Denn Vertrauen aufbauen ist ein Prozess. Es kann viele Monate dauern, bis 1on1’s sich „normal“ anfühlen und auch so genutzt werden, wie es eigentlich sein sollte. Gerade am Anfang dagegen ist es oft der Fall, dass viel geschwiegen wird. Weil die Situation ungewohnt ist, weil die Kultur noch nicht verankert ist, weil das Vertrauen noch nicht da ist.
Niemand fühlt sich wohl, wenn auf beiden Seiten des Tisches geschwiegen wird. Die natürliche Reaktion darauf, ist dass jemand spricht. Meist war ich das. Und weil ich nicht in der Lage war, komplett individuell live zu adaptieren, half mir auch mein vorbereitetes Template wenig. Natürlich gab es Teammitglieder, wo das Vertrauen aus langer gemeinsamer Vergangenheit da war, und wenigstens das Template genutzt werden konnte und auch Input kam.
Aber bei den meisten war es erst Schweigen, dann Fragen von meiner Seite, die schnell in Richtung des betrieblichen Alltags gingen, statt dorthin, wo sie sollen – zum Menschen.
Gut, wenn es andere besser können
Ich kann von Glück sagen, dass meine beiden Abteilungsleiter sehr viel besser darin waren, dieses wunderbare Instrument zu nutzen. Ich habe erst viel später, durch die Beobachtung ihrer Interaktion und die Reflexion von Erlebnissen während entsprechender Aufträge außerhalb meines Unternehmens gelernt, dass ich dieses Instrument zwar beherrsche – aber kein Meister darin war.
Schön, dass ich es spät gelernt habe, und nun weitergeben kann. Was wäre alles möglich gewesen, wenn ich es früher gewusst hätte? Wieder ein Grund mehr, der für Mentoring bei Nachwuchsführungskräften spricht. Aus den Fehlern anderer lernen kann enorme Kosten vermeiden – und den Lernprozess beschleunigen.
Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de