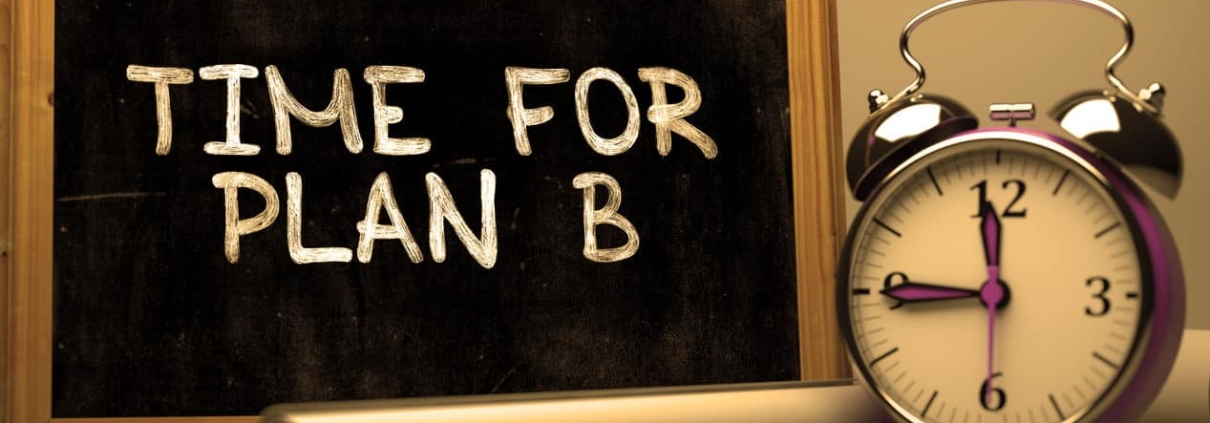Vor fast genau vier Jahren habe ich über das Thema Bürokratie einen Beitrag geschrieben. Gerade Stempel nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Deshalb möchte ich das Thema der vermeintlichen Stempelpflicht zum Auftakt des Jahres fortsetzen – mit meinen besten Erlebnissen aus 2022.
Was kaum jemand weiß: Es gibt keine Stempelpflicht
Ich verstehe gut, dass vor 100, 70 oder 50 Jahren ein Stempel noch etwas tolles war. Teuer in der Herstellung und deshalb Firmen und Behörden vorbehalten. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ich kann mir jeden Stempel der Welt für wenige Euro herstellen lassen. Die vermeintliche Legitimation, die damit verbunden wird, ist also keine. Wenn ich mir einen Stempel mit beliebigen Daten machen lassen kann, was genau legitimiert er dann? Die Antwort ist einfach: Nichts.
Dazu kommt, das in Zeiten digitaler Dokumente kein Sinn mehr darin liegt, diese zu drucken um dann zu stempeln. Das ist unnötiger Aufwand und vermeidbarer Ressourcenverbrauch. Für digitale Unterlagen gibt es eigene Lösungen zur Legitimation, die aber noch nicht weit verbreitet sind.
In diesem Zwiespalt der technischen Unzulänglichkeit halten also viele Stellen an den schönen Stempeln fest – und tun so, als müssten das alle. Das ist aber falsch. Es gibt keinerlei gesetzliche Vorschrift für Unternehmen, Stempel zu besitzen oder zu nutzen. In wenigen Berufen und an wenigen Stellen ist das, soweit ich recherchieren konnte, anders geregelt. Für einen Großteil der Menschen allerdings ist ein Stempel nur eins: Ein physischer Anachronismus, ein Symbol der Vergangenheit.
Der Hügel, auf dem ich zu sterben bereit bin
Jeder Mensch braucht den sprichwörtlichen Hügel, auf dem er oder sie zu sterben gewillt ist. Stempel sind mein Hügel. Ich diskutiere viele Male jedes Jahr mit Menschen darüber, warum ich keinen Stempel habe (weil ich das nicht muss und wenig hilfreich finde). Die Entrüstung, die mir entgegenschlägt, ist mir dabei ein Rätsel. Warum stehen so viele darauf, einen Stempel irgendwo zu haben?
Warum tut man so, als gäbe es eine gesetzliche Verpflichtung, indem man auf Formularen vorgefertigte Felder für den Stempel unterbringt? Was würde denn der Stempel sagen oder an Mehrwert bringen? Aus meiner Sicht: Weniger als nichts.
Und so durfte ich mit diversen Stellen im Laufe des vergangenen Jahres darüber diskutieren, warum ich keinen Stempel auf ein Blatt drücke. Und ich werde das gerne weiter tun. Denn es ist schlimm genug, dass man ihn wünscht – noch schlimmer finde ich, ihn zur Bedingung zu machen, wenn niemand verlangen kann, dass man einen besitzt.
Ein Auszug aus den Gesprächen
Ich bekam im Laufe des Jahres ein Formular einer Behörde, das nur mit den Quellen meiner Rolle als Geschäftsführer überhaupt auszufüllen ist. Keine andere Person hätte dieses Dokument sachlich korrekt ausfüllen können. Auf den Stempel habe ich, natürlich, verzichtet. Es passierte, was passieren musste: Das Dokument kam zurück, “Stempel vergessen“. Die Entrüstung über meine Antwort, dass ich schon lange keinen mehr besitze, war riesig. Aber man hat es, irgendwann, akzeptiert.
In der Kommunikation mit einem Dienstleister war ebenfalls auf dessen Bestellformularen ein Stempelfeld vorgesehen. Ich hakte nach: Ich würde gerne mein Team die Bestellungen machen lassen, ob es ok ist, dass kein Stempel darauf sein wird? Die Antwort war, für jemanden der täglich mit IT zu tun hat, erschütternd: Ja, das ist ok, wenn alle Bestellungen von meiner E-Mailadresse kämen. Nun weiß jeder, der etwas mit Computern zu tun hat, dass Mailadressen (insbesondere die sichtbaren) nicht als Validation taugen. Inwiefern das also mehr legitimiert, lasse ich mal offen.
Und, nicht zuletzt, eine Schule: Sie schrieb mich an, ob die Entschuldigung meines Auszubildenden auch wirklich über meinen Tisch gegangen sei, da kein Stempel darauf war. Ich musste lächeln. Zum einen, weil es schön war, dass man sich rückversichert (auch wenn das im konkreten Fall definitiv nicht nötig wäre) – zum anderen frage ich mich, was ein findiger Azubi denn tun würde. Als ob es unmöglich wäre, eine Unterschrift zu fälschen und einen Stempel von einem Tisch zu nehmen und zu nutzen. Das erscheint mir dann doch etwas weltfremd.
Mein Traum: Ehrlichkeit
Es wäre schön, wenn alle Firmen und Behörden hier einfach mal das alte Symbol entfernen würden. Keine vorgesehenen Felder für Stempel auf Formularen. Keine Diskussion um etwas, was freiwillig ist.
Bis das passiert, werde ich weiter meinen kleinen Hügel erklimmen und darauf kämpfen.
Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de