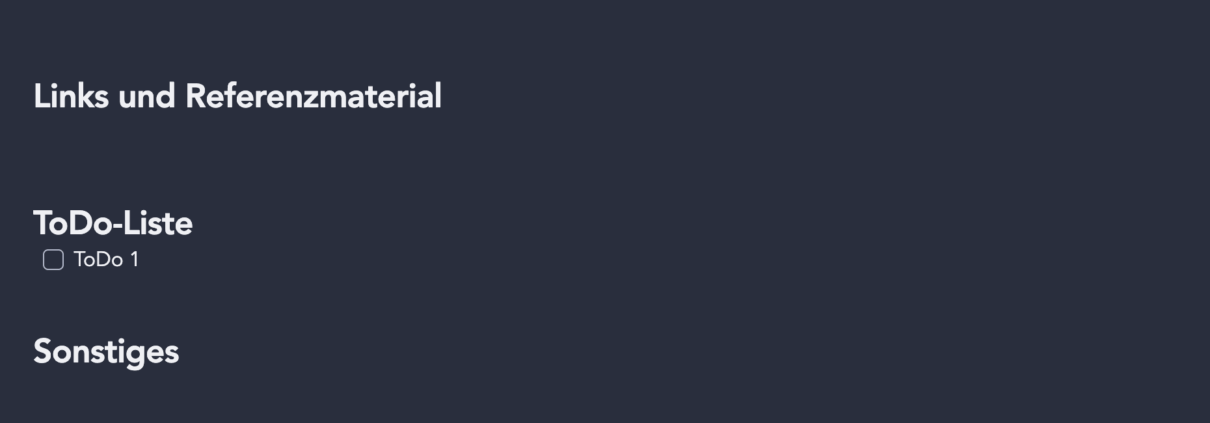Im letzten Beitrag zum Thema Produktivität schrieb ich von meinen Lektionen des vergangen Jahres. Darauf aufbauend hat sich Ende des ersten Quartals noch eine Erkenntnis gegeben, die ich unbedingt teilen möchte. Sie betrifft die Möglichkeit sogenannter Projektseiten.
Lange unklare Listen überfordern
Wenn man, wie ich, als Ordnungsschema für alle Projekte die sogenannten “Areas of Focus” aus GTD nutzt und darunter dann Projekte listet, kann diese Liste recht groß werden. An sich ist das kein Problem. Durch eine Trennung von Projektliste und der eigentlichen Aufgaben, wie ich sie im oben verlinkten Artikel sowie in der Beschreibung meines Planungsprozesses thematisiere, sollte sich die Übersichtlichkeit eigentlich bewahren lassen. Speziell, wenn man dann noch stark angelehnt am Time Sector System von Carl Pullein arbeitet, was sich auch weiterhin für mich bewährt hat.
Probleme entstehen vor allem dann, wenn die Aufgaben entweder keine Aufgaben sind (sondern Projekte), oder wenn sie so unklar formuliert sind, dass sie nicht einfach gemacht werden können. Soweit die Erkenntnis vom letzten Mal. Diese ist auch weiterhin richtig. Allerdings habe ich einen weiteren Fall gefunden, in dem mein System einen Hänger hat.
Was, wenn es viele kleine und dynamische Aufgaben sind?
Das Problem, das ich beschreiben möchte, ergab sich aus mehreren Projekten für dieses Jahr, in denen viel Dynamik ist – und auch viel Abhängigkeit von Faktoren, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. So bin ich im Orgateam für eine Konferenz, die kommendes Jahr im Saarland stattfinden soll, schreibe an meinem Buch und möchte auch, nach einer Pause, meine Selbständigkeit als Berater und Mentor vorantreiben.
In all diesen Projekten ergeben sich, manchmal konstant und manchmal schubweise, viele kleine Aufgaben. Andere, die ich eigentlich geplant hatte in einer Woche zu erledigen, wurden aufgrund von äußeren Einflüssen nicht erledigt, und wieder andere sind vom Input anderer abhängig, der nicht zum richtigen Zeitpunkt kam.
In diesem Fall kommt mein System an sich nicht an seine Grenzen. Wohl aber meine Lust, damit dann zu arbeiten und darauf zu vertrauen. Der Aufwand in der Verwaltung der Aufgaben im System, das wöchentliche Verschieben, das verursacht bei mir Frust. Ich ertappte mich dabei, wie ich begann, das System zu vernachlässigen. Das ist zutiefst menschlich und normal – aber auch der Beginn einer Spirale, die zwangsläufig in erhöhtem Aufwand mündet, wieder “aufs Pferd zu springen”.
Die Lösung: Externe Projektseiten
Die Lösung, die für mich aktuell funktioniert, sind externe Projektseiten. Auch hier kann ich mich wieder bei Carl Pullein bedanken, der das Thema in einem Youtube-Video aufgebracht hat. Statt also alle Aufgaben eines Projekts in meinem Taskmanagement zu verwalten, habe ich für die entsprechenden Projekte Ordner in meinem PKM (also im wesentlichen meinem Notizwerkzeug) erstellt. In dem Ordner sind eh alle Dokumente und Notizen zu dem Projekt – aber nun auch eine sogenannte Projektübersichtsseite.
Für diese habe ich mir ein simples Template gebastelt, das auf Knopfdruck vorausgefüllt wird. Dieses sieht folgendermaßen aus:
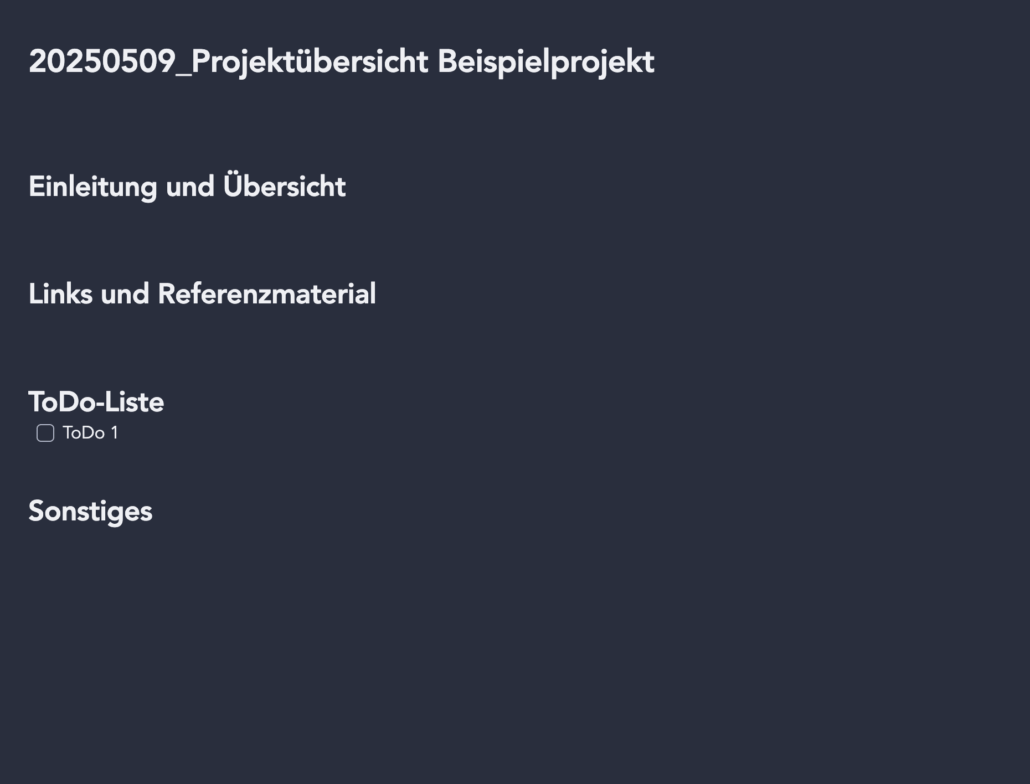
Mit dieser Vorlage kann ich sowohl Sinn und Ziel des Projekts festhalten, als auch eventuelles Referenzmaterial (sofern es zum Beispiel in einem Ordner liegt) und Links zum Projekt festhalten.
Viel wichtiger ist aber die ToDo-Liste. Denn dort kann ich nun alle Aufgaben eines Projekts pflegen und sie ohne großen Aufwand ändern, ergänzen oder löschen. In meinem Aufgabenmanagement selbst kommt jetzt nur noch ein Eintrag “An Projekt XYZ weiterarbeiten“, den ich wie bisher an den richtigen Stellen einplanen kann. Welche konkreten Aufgaben aus dem Projekt ich dann zu diesem Zeitpunkt mache, kann ich komplett von den Möglichkeiten und Umständen abhängig machen, in denen ich mich dann befinde. Falls noch ein Input zu Aufgabe A fehlt, mache ich eben Aufgabe B. Falls meine Zeit nur für D reicht, lege ich C zurück.
Diese Art Flexibilität passt besser zu einigen Projekten in meinem Leben – und der Link zu meinem Taskmanagement, das immer noch Dreh- und Angelpunkt meines Alltags ist, bleibt erhalten.
Die Trennschärfe leidet
Der Nachteil dieser Lösung liegt ebenfalls auf der Hand. Wenn man sich an GTD orientiert, ist die Trennschärfe von Begriffen wie “Area of Focus”, “Projekt”, “Aufgabe” oder “Referenzmaterial” mit dieser Aufweichung der strikten Handhabung aller Aufgaben in einem System nicht mehr gegeben. GTD-Evangelisten werden, teils zu Recht, argumentieren, dass reines GTD aufgrund von Kontexten und Filtern in der Lage wäre, mit dem beschriebenen Problem umzugehen.
Somit kann man sagen, dass mein Problem hausgemacht ist, denn die Anwendung der Komponente zeitliche Planung wie in meinem Fall ist in GTD methodisch nicht vorgesehen. Vielmehr soll alles so klar und herunter gebrochen sein, dass die zu tuenden Dinge sich aus dem jeweiligen Kontext und simpler schneller Entscheidungen ergeben.
Allerdings funktioniert mein System für mich. Und die Lösung mit den Projektseiten bislang ebenfalls. Und hier kommt wieder einmal das zu tragen, was ich in jedem Training oder Coaching zu diesem Thema sage: Es gibt nicht das richtige System. Es gibt das richtige System für Dich. Umso wichtiger ist es als Coach hier auf die Präferenzen und Bedarfe der Klienten einzugehen. Der Köder muss schließlich dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.