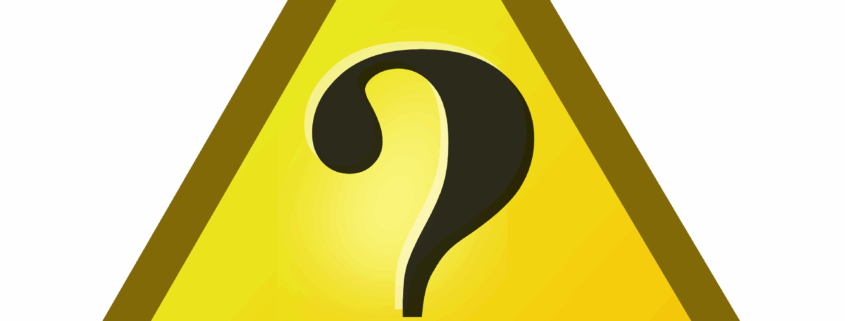Ich weiß nicht, wie oft ich auf mein Bauchgefühl hereingefallen bin. Es gibt unzählige Beispiele. Damit bin ich nicht alleine. Viele Menschen vertrauen darauf und manchmal kann es zutreffend sein. Wenn es allerdings mit seinem kongenialen Partner, dem Confirmation Bias, zusammen kommt, ist Vorsicht geboten.
Es ist schlecht, wenn Bauchgefühl zutrifft
Am Anfang meiner Zeit als Unternehmer habe ich gerade Personalentscheidungen oft aus dem Bauch heraus getroffen. Dabei war es egal, ob es um Kleinigkeiten (Gutschein, Gehaltsanpassung, oder kleine Vertragsanpassungen) ging, oder um die Einstellung einer neuen Person.
Besonders schlecht war, dass mein Bauchgefühl oft zutreffend war. Ich habe tolle Menschen eingestellt, die sich bewährten. Vertragsanpassungen waren richtig und auch die Erhöhung des Gehaltes brachten Freude und gute Leistungen. Das ist enorm gefährlich. Denn ich kam in die Schleife, die die allermeisten an dieser Stelle betreten: Mein Bauchgefühl brachte eine gute Entscheidung, also muss es immer Recht haben.
Leider ist das unglaublich gefährlich und im Nachhinein wäre es besser gewesen, ich hätte schneller öfter falsch gelegen. Denn mit dieser Denkweise schlägt der zweite Faktor voll zu.
Bestätigungsfehler werden zur Norm
Der Confirmation Bias, oder auf Deutsch Bestätigungsfehler, ist ein guter Partner für das Bauchgefühl. Lag ich richtig, sah ich nur noch das, was diese Annahme bestätigte. Fehler und Widersprüche hat mein Hirn konsequent ausgeblendet.
Die Folge: Selbst dann, wenn mein Bauchgefühl objektiv komplett falsch lag, vertraute ich darauf. Dieses sich selbst verstärkende System ist enorm gefährlich, denn es führt zu einem Gefühl der Sicherheit, das sich durch Fakten kaum oder gar nicht belegen lässt.
Ganz im Gegenteil. Die Fakten sprachen oft gegen meine Entscheidungen. Und ich merkte es nicht. Das kam dann später, meist auf schmerzhafte Art und Weise. Vor allem dann, wenn das eigene Team einem sagt, dass man falsch lag. Gerade bei Personalentscheidungen tat das enorm weh – nicht nur, weil es das eigene Ego ankratzt, sondern weil damit auch ein anderer Mensch beschädigt wird.
Objektivierung von Entscheidungen
Diese Erkenntnis ist keine Absage an das Bauchgefühl. Es hat seinen Platz, auch in wichtigen und großen Entscheidungen. Es sollte aber durch Daten und weitere Sichtweisen ergänzt werden, nicht durch die eigene Bestätigung. Diese ist nämlich von Vornherein falsch, sie entstammt ja dem eigenen Hirn. Dein Hirn mag keine Widersprüche und wird die Daten entsprechend filtern.
Je nach Entscheidung gibt es verschiedene Wege, Objektivierung zu betreiben. Bei Personalentscheidungen wurde es erst ausgeschaltet, als ich das Prozedere änderte und mehrere Runden (Kennenlernen, Fachgespräch und abschließende kulturelle Prüfung) mit mehreren Personen einführte. Theoretisch kann auch eine Gruppe komplett falsch liegen, es ist aber viel unwahrscheinlicher.
Bei anderen Entscheidungen hilft es, entweder selbst oder mit einem Sparringspartner alle möglichen Informationen und Optionen zu erwägen. Der YouTube-Channel von MentourPilot hat mir hier ein Modell beigebracht, das von Piloten angewendet wird, und das ich als hilfreich empfinde: FORDEC.
Das Kürzel steht für…
- Facts
- Options
- Risks
- Decision
- Execution
- Check
Mit Hilfe dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass mehr als nur die erste Option geprüft werden, Risiken einbezogen und nach der Entscheidung auch eine Evaluation stattfindet. Alles wichtige Schritte, um dem Confirmation Bias zu entgehen.
Bildquelle: Immo Schulz-Gerlach from Pixabay