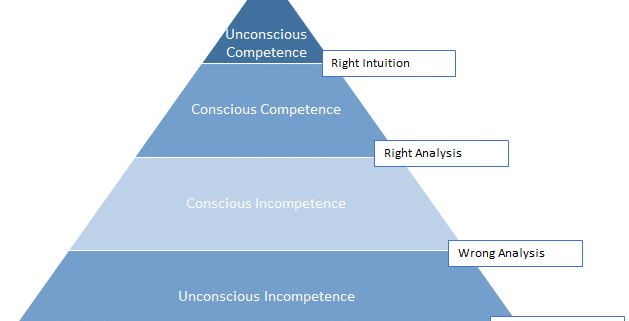Dieses Jahr hat viel Kraft gekostet. Mit meiner anstehenden Jahresreview, die ich jedes Jahr mache, weiß ich bereits jetzt, welcher Satzbestandteil öfter darin vorkommen wird: „…das war anstrengend“. Für die kommenden Jahre, und für Leadership, erwächst daraus eine wichtige Erkenntnis.
Ja, es darf auch mal mehr als 100% sein
Die Erkenntnis, dass Entspannung wichtig ist, ist nun wirklich keine „Rocket Science“. Das Bundesurlaubsgesetz sagt das, der gesunde Menschenverstand auch. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zuerst eine Lanze für die Anspannung brechen.
Die allermeisten Menschen brauchen ein gewisses Maß an Last, in dem sie sich wohlfühlen. 80, 90% sind Zahlen, die öfter genannt werden. Das verstehe ich, und habe diese Phasen natürlich auch. Es ist unmöglich, konstant über 100% zu bringen. Gesund erst recht nicht.
Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht aber auch wichtig, gelegentlich über die bisherigen eigenen Grenzen zu gehen. Die Betonung liegt auf „bisherige“. Es hat ein wenig was von Fitnessstudio. Wenn ich dort immer nur so lange Übungen mache, wie ich mich wohl fühle, werde ich die Limits, also das, was meine 100% sind, niemals erweitern.
Persönliches Wachstum erfordert über die Grenze zu gehen
Genauso ist es auch bei allem anderen, zum Beispiel im Arbeitsleben. Wer sich immer innerhalb seiner Limits bewegt (das, was gerne mal Komfortzone, etwas despektierlich, genannt wird), dehnt diese Limits niemals aus.
Das Ergebnis ist mangelnde, weil nicht vorhandene Weiterentwicklung. Um diese zu ermöglichen müssen wir die Grenzen erreichen und überschreiten, seien es körperliche oder mentale Grenzen. Es ist wie jedes Muskeltraining, nur dass dieser „Muskel“ das Gehirn ist.
Für das Training braucht es Anspannung (das Überschreiten der bisherigen Grenzen) und Entspannung.
Achte auf Dich und auf andere
Für Führungskräfte erwächst daraus eine besondere Verantwortung. Sie können anderen bei der Entwicklung helfen, indem sie für diese Anspannung sorgen. Neue Verantwortungsbereiche, neue Themen, neue Projekte, all das kann dazu dienen, einen anderen Menschen an seine oder ihre Grenzen heranzuführen – und, mit Hilfe durch die Führungskraft, diesen Schritt erfolgreich zu bewältigen.
Gleichzeitig bringt es auch die Verantwortung mit sich, für die notwendige Entspannung zu sorgen. Achtet auf Eure Mitarbeitenden. Sorgt dafür, dass sie Urlaub machen (ungestört!), unterstützt es durch ordentliche Übergabeprozesse und Wissensverteilung. Auf diesem Wege werdet Ihr dem Anspruch an Leadership gerecht.
Denkt an das Vorbild
Und eines sollte man dabei nicht vergessen: Sich selbst! Wenn man Wasser predigt („Macht bloß Euren Urlaub!“) und Wein trinkt (selbst keinen machen) ist das nicht nur ein schlechtes Vorbild.
Die Dissonanz zwischen Worten und Taten führt dazu, dass andere diese Handlungsweise imitieren, wie ich vor einiger Zeit gebloggt habe. Das Ergebnis mag kurzfristig attraktiv sein, da ein hohes Leistungsniveau erreicht wird. Langfristig führt es zu ausgebrannten Menschen, deren Leistungsvermögen dauerhaft sinkt.
Es ist wie so oft im Leben: Zu wenig ist nicht gut, zu viel auch nicht. Die Mischung macht es!
PS: Ich werde dieses Jahr, wie auch schon vergangene, mit einem Jahresrückblick beenden. Dieser erscheint voraussichtlich am 20. Dezember 2023, dann ist erst mal Pause bis nach dem Jahreswechsel.
Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de